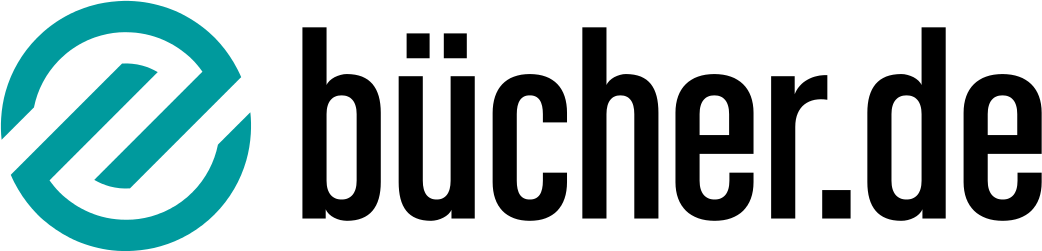Irgendwie finde ich die Leseprobe bei Amazon etwas zu wenig.
Wenn ich bei anderen Leuten in die Bücher sehe, gibt es da viel mehr Seiten zu lesen.
Ich werde jetzt hier die ersten 24 Seiten rein setzen. Aber ich nehme die Trennstriche nicht raus.
Für den nachfolgenden Text liegen alle Rechte bei M.l.Giesen- Autorin.
Und nicht vergessen, es ist erst ab 16 Jahren aufwärts.
ISBN 978-3-86870-811-0
Copyright (2015) Re Di Roma-Verlag
Alle Rechte beim Autor
www.rediroma-verlag.de
13,95 Euro (D)
Lieber Leser!
Ich hoffe, dieses Buch wird nicht eines Tages nur dadurch be-kannt, weil es den Beititel bekommt; Als meine Fehler laufen lern-ten.
Einem Lektor sind diese geschriebenen Wörter genau so unbe-kannt, wie dir lieber Leser, sein Autor.
Solltest du Fehler entdecken, dann lächle und denke daran, dass Autoren auch nur Menschen sind.
Und freue dich mit mir, dass ich mich getraut habe, meine Ge-schichte zu veröffentlichen.
Mögest du in sie eintauchen, so wie ich es immer wieder tu.
Liebe Grüße, M.L.Giesen
Dramatis Personae
Renaldo Renaldidi von Atschania, 185 Jahre alt.
Durch einen Fluch kann er nicht im Dämmerlicht, dem Land der Götter bleiben und der Tod schickt ihn jedes mal zurück, wenn er stirbt. Doch seine Wunden brauchen ihre Zeit zum Heilen.
Als mittelloser Bastard führt er ein kriegerisches Leben und fühlt sich nirgends willkommen. Auch er trägt das Erbe der ewigen Ju-gend in sich. Blaue Augen und weiße Haare stempeln ihn als Außenseiter ab im Land der Kurzlebigen, wie auch im Land der langlebigen Arben.
Er besitzt die Gabe eines Gestaltwandlers und ist der Weiße-Drache. Schon seit tausenden von Jahren gab es keinen Weißen-Drachen mehr mit der Macht des Feuers, doch er will dieses Schicksal nicht.
Frankanas, Barde von Firndorn, 1323 Jahre alt.
Er ist ein reicher adeliger Arbe mit großem Einfluss und ist ge-wohnt, dass man sich ihm beugt. Außer seinen Liedern frönt er auch noch anderen Neigungen, die er voll genießt, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Das Erbe seines Volkes ist die ewige Ju-gend und ein langes Leben, so lange ihn keiner tötet.
Dravos, Fürst der Wolfskrieger, 1567 Jahre alt.
Freundlich im Wesen, immer mit einem Lächeln im Gesicht ist er trotz allem ein Wolf, ein Gestaltwandler. Diese Gabe wurde sei-nem Volk erhalten, aber es ist nicht mehr so groß, wie zur Zeit der Drachenkriege. Seine Heimat ist der Ewige-Sommerwald der Wöl-fe.
Er gehört zum Volk der langlebigen Arben und hat seit 600 Jahren eine Liebschaft mit dem Barden Frankanas. Er kommt und geht und nimmt es mit der Treue nicht so genau, er ist halt ein Wolf. Doch als der Drachenkrieger in das Leben des Barden tritt, hat das Wort Eifersucht für den Wolf einen üblen Beigeschmack- Angst.
Angst, die Liebe seines Barden zu verlieren.
Eltras, ein Arbe von Firndorn, 800 Jahre alt.
Er widmet sich der Kunst der Bilder, und geht eine Beziehung mit Frankanas ein. Doch die macht ihn nicht glücklich, da auch er nur ein Spielzeug ist, dass die Lust des Barden stillt. Und doch würde er alles für diesen Mann tun.
Rochon, ein Schlangenkrieger aus Elschandei, 12068 Jahre alt.
Seine Heimat ist die Wüste und er ist ein Freund des Barden. Sein Volk besitzt die Gabe, die Gestalt einer Schlange anzunehmen und kennt sich mit Giften aus.
Rochon hat auch die Macht des Geistlesers, was ihm die Möglich-keit gibt, in den Erinnerungen anderer zu forschen. Seine charisma-tische Art täuscht viele über seine wahren Beweggründe, denn er will nur seinen Gefährten Rondor zurück, den er seit 4000 Jahren sucht.
Hadis, ein Arbe in Firndorn, 7020 Jahre alt.
Besitzer und Wirt von der Spelunke
Hadon, ein Arbe in Firndorn, 4509 Jahre alt.
Anführer der Musikergruppe in der Spelunke
Aus den Erinnerungen des Drachenkriegers
Ronna, eine Kurzlebige, 70 Jahre alt
Sie lebt im Dorf am Ende der Welt, wie sie ihr abgeschiedenes Dorf liebevoll bezeichnet und zog den Drachenkrieger trotz ihres hohen Alters auf, als seine Mutter ihn im Gasthof nach seiner Ge-burt liegen lies. Sie brachte ihm alles über Kräuter bei.
Ulhir, ein alter Mönch
Im Drachenkloster lernte er im Alter von 22 lesen und schreiben, Fremdsprachen und kämpfen.
Meine Sinne kehren langsam zurück, aber noch fällt es mir schwer, mich zu erinnern. Ich versuche, den Nebel aus meinen Gedanken zu vertreiben. Dies ermüdet mich und ich gleite zurück in den Schlaf. Etwas später lässt ein Geräusch mich erneut wach werden und ich habe den Eindruck in einem Käfig zu sitzen, denn ich spü-re Gitterstäbe, die sich unangenehm an meine Haut drücken. Ich schüttle den Rest der Benommenheit von mir ab und kann das Ge-räusch zuordnen, das mich geweckt hat. Und bin alles andere als erfreut darüber, dass ich mich in einem fahrenden Käfig befinde. Es war das Rumpeln der Räder, das mich aus dem Schlaf holte.
Ich blicke in bekannte Gesichter und es scheint früh am Abend zu sein. Schmutzige Decken, die über den Gitterstäben hängen, wei-sen an einigen Stellen Risse auf, sodass das Licht, das durch sie in unseren Käfig fällt, den Eindruck eines späten Tages vermittelt. Man hat uns in diesem fahrenden Gefängnis eingesperrt wie Vieh, das auf dem Weg zum Schlachthof ist.
Die Zunge klebt mir am Gaumen und ich verspüre Durst. Einer der Männer bietet mir in einem dreckigen Becher abgestandenes, übel riechendes Wasser an. Ich muss mich überwinden ihn zu lee-ren und habe kein Verlangen nach mehr, obwohl diese paar Schluck Brühe meinen Durst nicht gelöscht haben. Sie hinterlassen einen ekeligen Geschmack und der Geruch von Urin, Kot, Blut, und Kotze trägt auch nicht gerade zu einem besseren Gefühl bei. Ich frage nicht, was das Summen der Todesfliegen bedeutet, das ich erst jetzt bewusst höre. Drei tote Krieger liegen in unserem menschenunwürdigen Gefängnis. Es macht mich wütend, dass man uns nicht die Möglichkeit gibt, sie würdig zu begraben.
Ich frage meine Männer, ob sie sich an irgendetwas erinnern, wo-raus man schließen kann, in wessen Feindeshände wir uns befin-den. Sie können nur das berichten, was in jener Nacht auf dem Schlachtfeld geschah.
So gehe ich in Gedanken ein Stück in meiner Erinnerung zurück zu dem Ort, wo unser jetziger Zustand seinen Anfang nahm.
Ich war damals schon Hauptmann, als uns die Waffen nach Bat-scharien, in das Land der langlebigen Arbenvölker führten. Einige trugen ihren Krieg in die Länder der Kurzlebigen, um sich das zu-rückzuholen, was sie ihnen in einer sagenumwobenen Vergangen-heit genommen haben.
Nachdem wir das Reisetor fanden, durch das sie zu uns kamen, beschlossen unsere Generäle, dass wir den Tod zu ihnen bringen. Wir brannten Dörfer und kleine Städte nieder, unterbrachen ihre Versorgung. Der Feind zog sich zurück und wir blieben ihm un-barmherzig auf den Fersen. Dass sie uns letztendlich in eine Falle lockten, konnte keiner von uns ahnen.
Die zwei Monde spendeten in jener Nacht genug Helligkeit, so-dass tief unter ihnen in ihrem Zwielicht die Schlacht in der grauen Ruhlansteppe weiter tobte. Unsere Feinde tränkten mit ihrem Blut den Boden, doch auch aus unseren Reihen haben tapfere Krieger ihre letzte Reise zu ihren Göttern angetreten. Der Kriegsgott stillte in dieser unheilvollen Nacht seinen Hunger an den armen Seelen der Gefallenen.
Wir kämpften mit dem Mut der Verzweiflung und so langsam wendete sich das Blatt zu unseren Gunsten.
Dass der graue Himmel sich verdunkelte, davon nahm niemand Notiz. Der Feind forderte unsere ganze Aufmerksamkeit. Als mei-ne Ohren in einer Atempause für einen winzigen Moment das leise Geräusch von schlagenden Flügeln vernahm, erhob ich meinen Blick.
Dies hätte mir beinah das Leben gekostet, nur indem ich mich nach hinten in das Blut meiner Feinde fallen ließ, entkam ich dem gefiederten Tod. Was ich sah, ließ meine Seele frieren.
Graue Flugtiere, auf denen ein uns überlegender Feind saß, ver-dunkelten den Himmel. Unsere Gegner am Boden fassten neuen Mut und sie sangen Lieder, während ihr Stahl Leben nahm, als die Reiter in der Luft Gefäße auf uns warfen.
Sie platzten am Boden auf und weißer Rauch quoll aus ihnen, der sich schnell ausbreitete. Ungläubig musste ich mit ansehen, wie meine Krieger ihre Waffen fallen ließen und zu Boden sanken. Unsere Feinde blieben von diesem Rauch verschont. Arben blick-ten mich mit kalten Augen an, während ich keuchend nach Luft ringend zu Boden sank. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in diesem Käfig.
Mir fällt auf, während ich meine Männer betrachte, dass nur junge Krieger mich umgeben. Was ist mit den Älteren geschehen? Vage vermute ich, dass sie auf dem Schlachtfeld geblieben sind, getötet von unseren Entführern.
Ich vernehme leise Stimmen, das Schnauben von Pferden, das Rumpeln von Rädern und schließe daraus, dass wir nicht die einzi-gen Gefangenen sind. Aber wer sind unsere Wächter? Nach dem Knall einer Peitsche schreit jemand qualvoll auf, begleitet von einem hässlichen Lachen.
Mein Versuch, ein Ende der Decken anzuheben, um einen Blick auf unsere Feinde zu erhaschen, wird mit einem zischenden Peit-schenhieb bestraft. Ihr Biss frisst sich schmerzvoll in meinen Unterarm und trinkt mein Blut.
Es reicht nicht, uns in diese unwürdigen Käfige zu sperren, wir werden zusätzlich streng bewacht. Ich frage mich warum, zumal unter uns keine Hochgeborenen sind, deren Gewicht man mit Gold aufwiegen kann. Die haben es vorgezogen, diese Schlacht auf den Kartentisch zu gewinnen, weit weg von Bruder Tod.
Wohin bringt man uns? Keiner weiß, wie lange wir unterwegs sind. Durch die schwüle Luft verwesen die Leichen schnell und ihr Gestank erschwert uns das Atmen. Der Schweiß rinnt uns aus den Poren und einige haben ihre Stiefel und Oberkleidung ausgezogen. Hunger und Durst schwächt uns und wir haben keine Möglichkeit, unsere Wunden zu versorgen. So bleibt es nicht aus, dass zwei wei-tere Krieger zu ihren Göttern gehen.
Die Todesfliegen umschwirren auch uns und so ist immer einer damit beschäftigt, sie zu verscheuchen. Sie waren schon auf dem Schlachtfeld eine Plage. Die Zeit in diesem Käfig ist zäh, dieses ungewisse Schicksal zerrt an unseren Nerven.
Ich schnappe leise Wörter in einer mir fremden Sprache von unse-ren Wächtern auf, doch sie klingen gedämpft, als ob sie eine Maske tragen. Zu einer ungewöhnlichen Zeit halten wir an, die letzte Rast der Zugtiere liegt nicht lange zurück. Hatte ich nicht den Eindruck, als ob es steil hinunter ging?
Grelles Licht blendet uns, als man die Käfigtür öffnet und uns hinaus scheucht. Da wir nicht schnell genug sind, hilft man mit Speeren nach, die sie durch die Gitter stoßen.
Vor uns steht ein Wasserbecken und als einige Gefangene darauf zueilen, schlagen Wächter mit ihren Peitschen auf sie ein. Einer spricht mich mit einem harten Akzent an und es dauert einen Mo-ment, bis ich den Sinn seiner Worte verstehe. Zu meinen Männern sage ich: „Sie verlangen, dass wir uns ausziehen, die Kleidung in das Feuer werfen und säubern. Wer Wasser trinkt, wird ausge-peitscht.“
Diszipliniert stellen sie sich auf, der Erste zieht seine Kleidung aus, wirft sie in das Feuer und geht in das Wasserbecken. Da ich der Letzte in der Reihe bin, nutze ich die Gelegenheit und zähle sie. Es sind Hundert, übrig von Tausend, die erschlagen und zer-stückelt auf dem Schlachtfeld liegen, wo Baumratten und Wölfe sich an ihnen satt fressen.
Sklaven betätigen die Wasserpumpen. Anscheinend legt man großen Wert darauf, dass wir sauber sind. Obwohl ich eher denke, dass sie verhindern wollen, dass wir irgendwelche Krankheiten einschleppen.
Ich betrachte die Umgebung und sehe hohe Felsen, die diesen Ort umschließen. An Felswänden schmiegen sich zweistöckige Bauten mit flachen Dächern, doch sie wirken trostlos mit dem ver-gitterten Fenstern und dem fast farblosen Efeu, der versucht, ihre Wände zu erobern. Es gibt nur einen Zugang, denn ich meine, das Knirschen von Scharnieren gehört zu haben, als ein Tor hinter uns geschlossen wurde.
Wir befinden uns auf einem Platz, der im Halbkreis von einer Sitztribüne abgegrenzt wird. Dahinter macht eine hohe Mauer mit Wachtürmen jeden Fluchtgedanken zunichte. Mit anderen Worten, ein perfektes Gefängnis. In der Mitte der Häuser entdecke ich einen Durchgang, den ein schweres Eisentor versperrt.
Die Reihe vor mir wird kürzer und unsere schwer bewaffneten Wächter tragen immer noch ihre Masken. Auf den Türmen und Dächern halten Bogenschützen ein wachsames Auge auf uns. Wü-tend zerre ich meine schwarze Lederkleidung vom Leib. Doch als ich sie in das Feuer werfen will, kommen Sklaven auf mich zu und fordern sie ein. Ich lasse mich in das kalte Wasser fallen, genieße trotz der Umstände das Gefühl von Sauberkeit und ignoriere die Blicke unserer Wächter.
Anschließend bringen Sklaven Eimer mit Wasser und Kellen, endlich dürfen wir so viel trinken, wie wir wollen. Ruhig stellen sich meine Männer in zwei Reihen auf. Danach bekommt jeder eine Decke und ein Stück Brot, bevor man uns in eine geräumige Ge-fängniszelle sperrt. Der Boden ist sauber und es gibt genug Platz, um sich hinzulegen. Ich steuere eine Ecke an, die man mir, ohne zu murren überlässt. Nicht weit von mir liegen zwei, die miteinander befreundet sind und niemand stört sich daran, dass sie sich gegen-seitig Trost geben. Ihr leises Stöhnen begleitet mich in den Schlaf.
Am nächsten Morgen werde ich von dem Geruch von frischem Brot wach, dass mir jemand vor die Nase hält. „Wach auf, mein Hauptmann. Es gibt etwas, das solltest du dir ansehen.“
Meine Männer stehen im Kreis und öffnen eine Gasse für mich. Entsetzt blicke ich auf die zwei Toten, die entmannt auf dem Bo-den liegen. Am Gitter steht der Anführer unserer Feinde. Er trägt keine Maske und schwarzes Haar umrahmt sein stolzes Gesicht. Auch wenn er fast flüstert, so höre ich dennoch seine Worte. „Unsere Gebieterin duldet so etwas nicht!“
Wütend frage ich: „Hätte töten nicht gereicht? Musstet ihr ihnen auch noch ihre Würde nehmen?“
„Wir können euch nichts wegnehmen, was ihr nicht habt“, ant-wortet er mit kalter Stimme.
„Wer seid ihr, dass ihr euch anmaßt, darüber zu richten“, frage ich. Schweigend geht er, bleibt auf halben Weg stehen, dreht sich um und blickt mich spöttisch an.
„Hast du es immer noch nicht begriffen? Wir sind euer Tod!“ „Warum, sag mir warum“, und ich habe Mühe, meine Stimme ruhig klingen zu lassen.
Schon allein für sein süffisantes Lächeln hätte ich ihm den Hals umdrehen können, als er äußert. „Weil ich es kann. So einfach ist das.“
Ich spüre ihr Entsetzen und ihre Verzweiflung, als meinen Män-nern die Tragweite dieser Worte bewusst wird. Einer drückt mir ein Stück Brot in meine Hand und sagt mit belegter Stimme: „Lass gut sein, mein Hauptmann, auch uns fehlen die Worte.“ Den Rest des Tages verbringe ich schweigend. Das leise Murmeln meiner Krieger begleitet mich in den Schlaf.
Nach einer zu kurzen unruhigen Nacht mit bösen Träumen we-cken mich aufgeregte Stimmen. Unsere Wächter scheuchen uns aus der Zelle. Grelles Sonnenlicht blendet mich, als ich nach draußen stolpere. Wir müssen uns in vier Reihen aufstellen. Auf der Tribüne sitzt ein Publikum, das uns voller Hass anstarrt.
Sie sind hier, weil sie Blut sehen wollen. Unser Blut! Auf den Dächern stehen Bogenschützen, die ihre angelegten Pfeile auf uns gerichtet halten.
Krieger treten vor, nehmen ihre Umhänge und Masken ab. Das Publikum jubelt ihnen zu. Es sind Schwarzarben und ich frage mich, weshalb sie uns gefangen nahmen. Mit ihnen lagen wir nicht im Krieg. Warum haben sie sich mit unseren Feinden verbündet? Seltsam finde ich, dass ich nur meine Männer sehe. Einige erzähl-ten mir, dass es auch andere Gefangene gibt.
Erbarmungslos mustern sie uns und zerren einen aus unserer Mit-te. Speere werden auf mich gerichtet, als ich mich an seine Seite stellen will. Ein blondhaariger Arbe stößt mich zurück. Seine grü-nen Augen versuchen, mich einzuschätzen. Trotzig erwidere ich seinen Blick. Erstaunt weiten sich seine Pupillen, als er den Dra-chenkrieger in mir erkennt. Er geht, dreht sich aber noch mal um und sieht mich nachdenklich an. Warum teilt er sein Wissen nicht den Anderen mit?
Böse Rufe kommen aus den Reihen des Publikums. Mein Mann steht verloren in der Mitte des Platzes. Er hat eine Familie, die ver-geblich auf ihn warten wird. Er weiß, dass der Tod ihn heute er-wartet. Mutig blickt er ihm ins Auge. Es wird ruhig, als zwei Krie-gerinnen den Platz betreten. Hilflos muss ich zusehen, wie sie ihn hinrichten. Wachsame Wächter hindern mich daran, ihm zu Hilfe zu eilen. Die Kriegerinnen stechen weiter auf ihn ein, als er blutend am Boden liegt und lachen über seine Schreie.
Einer unserer Wächter ist kurz unaufmerksam und ich stoße ihn zu Boden, zerre ihm seinen Speer aus der Hand. Mit ein paar schnellen Sätzen bin ich bei den Kriegerinnen und reiße einer mit der Speerklinge den Bauch auf. Aus einer Drehung heraus jage ich der anderen die Klinge durch ihre Kehle.
Mit Zorn in meinen Augen schleudere ich den Speer von mir, als Pfeile warnend vor den Füßen meiner Männer in den Boden zi-schen.
Die Zeit bleibt stehen, als der Speer sich in ein schlagendes Herz bohrt und der blondhaarige Arbe in die Knie bricht. Seine Hände umfassen den Schaft und grüne Augen blicken mich ungläubig an, während das Leben aus ihnen flieht.
Ich löse mich von seinem Anblick und eile zu meinem am Boden liegenden Mann. Er will etwas sagen, aber außer einem leisen Stöhnen kommt nichts über seine Lippen. Ich setze mich zu ihm und halte ihn in meinen Armen. Er lächelt, als er zu seinen Göttern eilt und mit Hass im Herzen stehe ich auf.
Lachend richten sie ihre Speere auf meine Männer und nehmen zwanzig Leben. Einfach so, weil sie es können. Danach scheuchen sie den Rest zurück in die Zelle. Ich will mich ihnen anschließen, doch man hindert mich daran. Sklaven kommen und bringen die Leichen meiner Männer fort. Der Anführer der Schwarzarben be-tritt den Platz. Seine Stimme klingt eisig.
„Du hast zwei meiner Kriegerinnen brutal abgeschlachtet. Bist du jetzt zufrieden?“ Ich erwidere seinen kalten Blick und antworte: „Ich gehe mal davon aus, dass dies hier gerade keine Hinrichtung meiner Männer war. Klär mich auf, falls du das kannst.“ Er meint lachend: „Nenn es Rache, wenn du damit besser schlafen kannst, Hauptmann der Toten.“
Mit diesen Worten lässt er mich stehen, kehrt mir den Rücken zu. Ein brutaler Schlag in mein Kreuz lässt mich zu Boden krachen, als ich mich auf ihn stürzen will. Ein Krieger greift in mein Haar, zwingt mich auf die Knie und hält eine Rundklinge an meine Keh-le. Ich spüre den Druck der scharfen Schneide an meiner Haut und stelle mir vor, wie sie durch meine Kehle gleitet und ich qualvoll nach Luft schnappend an meinem Blut ersticke.
Eine zornige Stimme ertönt. „Nein, ihn werde ich mit Vergnügen persönlich zu Tode foltern, wenn seine Männer tot sind.“ Man zerrt mich hoch, reißt meine Arme nach hinten und bindet meine Hände zusammen. Sie schleifen mich zu einen Pfahl und ketten mich mit Armschellen an ihn. Ein Schwarzarbe flüstert voller Hass in mein Ohr, als mein Blick auf den toten Arben fällt.
„Dieser Verräter! Tausend Leiden und mehr werden nicht ausrei-chen dafür, dass du uns um unsere Rache betrogen hast. Wie fühlt es sich an, wenn man aus Unwissenheit einen Verbündeten tötet?“
Er schlägt mir noch in den Magen, bevor er geht. Das Publikum ist auch fort und so wie es den Anschein hat, muss ich die Nacht hier am Pfahl verbringen. Wenn nur der Durst mich nicht so quälen würde. Um mich davon abzulenken, betrachte ich meine Feinde.
Die meisten haben schwarzes langes Haar, das sie offen tragen. Ihre schlanken Körper sind durchtrainiert, ihre Augen dunkelbraun und ihre Haut ist leicht gebräunt. Sie sind gefährlich und ernst zu nehmende Gegner, denn ihre Fechtkunst ist legendär. Ihr Stolz erweckt bei vielen den Eindruck eines arroganten Volkes. Wer nicht auf gleicher Stufe mit ihnen steht, ist in ihren Augen Ab-schaum.
Der Schein der zwei Monde leuchtet mir ins Gesicht und der Nachtwind lässt mich frieren. Auch habe ich ein dringendes Be-dürfnis und spreche meine Wachen darauf an. „Meine Blase drückt.“ Sie äußern höhnisch: „Sollen wir ihn dir halten oder was?“ Als ich uriniere, fluchen sie: „Barbarischer Abschaum, verdammt sollt ihr sein. Was wollen die Götter mit Ungeziefer?“
Irgendwann ist diese Nacht vorbei und ich betrachte den Him-mel, als der Tag anbricht. Das Phänomen, dass sein Blau immer mehr verblasst, beobachte ich schon seit vielen Jahren. Auch die Hexer wussten nicht, warum dies so ist. Man kann durch einen tiefen Wald mit grauen Himmel reiten, ein paar Tage später kommt man in ein Dorf mit blauen Himmel. Etliche Orte weiter kann das schon wieder anders sein.
Viele neue Tempel wuchsen wie Unkraut empor, selbst in den entlegensten Orten. Der Ruf nach den Göttern wurde groß in An-betracht der Veränderung, dessen Ursprung niemand kennt. Sie haben Reisetore, die den Weg verkürzen, aber dass der Himmel sich verändert, schieben sie auf die Magie und die Hexer. Hauptsa-che die Sonne bleibt rot und warm, weiter denken die meisten Völker nicht.
Ich denke, es muss mit den Drachenkriegen zu tun haben, die vor sechstausend Jahren vieles veränderten. Sie gingen als der tausend-jährige rote Tod in die Geschichte ein. Damals wurde dieses Phä-nomen das erste Mal entdeckt. So stand es in den Chroniken vom Drachenkloster. Es soll ganze Landstriche mit einen grauen Him-mel geben.
Ich blicke erstaunt auf, als ein Arbenhexer den Platz betritt. Er malt mit Hingabe und Vorsicht mit weißem Pulver Runen auf den Erdboden. Anschließend zieht er einen großen Kreis um sie, den er nicht betretet. Er lässt eine Stelle frei und bleibt abwartend stehen.
Die Sitzbänke bleiben leer. Schwarzarben scheuchen fünf von meinen Männern vor sich her und stoßen sie in den Kreis. Der Hexer schließt die Lücke. Krieger erscheinen, stellen sich im Halb-kreis auf und verbergen ihr Gesicht hinter Masken. Ihr Anführer tritt an meine rechte Seite und raunt mir zu: „Fühle dich geehrt. Heute gibt es eine Sondervorstellung, nur für dich.“
Unnatürlich laut höre ich die Herzen meiner Männer schlagen, als der Arbenhexer mir roten Rauch in mein Gesicht haucht. Ich fühle ihre Angst und es kommt mir vor, als ob ich mich mitten unter ih-nen befinde, obwohl ich mir des Pfahles in meinem Rücken be-wusst bin. Die Enge der Schellen macht meine Oberarme taub und jede Bewegung ruft schmerzhafte Stiche hervor. Wie kann ich an zwei Orten gleichzeitig sein?
Mein Atem geht heftig, als die Angst mich einfangen will. Ich ta-ste mit den gefesselten Händen über das Holz und denke, dies hier ist real. Auch fühle ich die feuchte Erde unter meinen nackten Fü-ßen. Dann spüre ich die Stille, in der sich das Böse verbirgt. Es ist, als ob eine Faust sich um meine Seele legt und mir den Mut zum Leben nimmt. Tränen um das Verlorene rinnen über mein Gesicht.
Ich erkenne die Hoffnungslosigkeit in ihren Gesichtern, als sie zu mir sehen. Sie sind im weißen Kreis gefangen und können seine Grenzen nicht überschreiten. Die Runen ängstigen sie, als sie in hektische Bewegungen geraten, sich zu grotesken Wesen formen. Mit jedem Atemzug nehmen sie festere Konturen an. Nebel tritt aus dem Boden und verhüllt ihre wahren Gestalten vor unseren Augen. Noch!
Eine Eiseskälte nimmt von mir Besitz, als ich den Ruf des Todes höre. Der Schwarzarbenanführer neben mir lacht hämisch, als ich an meinen Fesseln zerre.
Weit entfernt und doch so nah heult ein Wolf. Die Klage über seine Einsamkeit erschüttert mich. Der Nebel verzieht sich, die Verwandlung ist abgeschlossen und ich meine, das fröhliche La-chen einer Frau zu hören. Oder gaukelt meine Hilflosigkeit mir die Sehnsucht nach einer Hoffnung vor, die ich hier nicht finden wer-de?
Meine Männer keuchen vor Schreck auf. Sie werden mit einem Feind konfrontiert, gegen den sie keine Chance haben.
Zehn schwarze Wölfe, die aus dem Reich der Magie gekommen sind, um die Seelen ihrer Opfer zu holen. Meine Männer stehen Rücken an Rücken, wohl wissend, dass es vor diesem Tod kein Entkommen geben wird.
Unsere Feinde überlassen nichts dem Zufall. Zehn Wölfe gegen fünf nackte geschwächte, waffenlose Krieger. Eine grausame Iro-nie des Schicksals, denn sie hätten auch gegen die Hälfte keine Chance gehabt.
Die Bestien umkreisen paarweise erbarmungslos ihre Beute, neh-men ihren Geruch auf und laben sich an ihrer Furcht. Lautlos grei-fen sie an und meine Männer wehren ihre Bisse vergebens mit ihren Händen ab. Das erste Blut fließt. Die Verletzungen sind schmerz-haft und brennen wie Feuer. Ich fühle ihre Qual, fühle die Glut, die sich durch ihre Wunden frisst, als ein Arbe mir seine Peitsche über meinen Körper zieht. Heiß rinnt mein Blut zu Boden.
Die Wölfe haben ihre Opfer gewählt und lassen von ihnen ab. Da es nur fünf gibt, werden sie um sie kämpfen. Schwerverletzt liegen meine Männer am Boden und müssen hilflos mit ansehen, wie die Wölfe brutal übereinander herfallen.
Sie teilen sich in zwei Gruppen auf und beginnen mit ihrem eige-nen Todestanz. Sie fletschen ihre Zähne bis zum Ansatz. Tief aus ihrem Innern kommt das Grollen ihrer Kehlen, als sie sich auf ihre Rivalen stürzen und sich in deren Hälse verbeißen. Ihr Blut verätzt den Boden und schwarzer Rauch quillt aus den Wunden, die sie sich zufügen. Sie haben auch für Ihresgleichen kein Erbarmen und zerreißen ihre Gegner mit Hass und dem eisernen Willen zu siegen.
Die Herzen meiner Männer schlagen durch meine Brust. Der Rhythmus ihres schwindenden Lebens droht mich zu zerbrechen. Es fühlt sich so echt an.
Dies macht es mir schwer, den Unterschied zwischen Magie und Realität zu spüren. Einer der Männer hat sich erhoben und sieht zu mir. „Hauptmann, geh dagegen an. Dies ist nicht dein Kampf!“ Seine Worte brechen den Bann und ich kann wieder frei atmen. Doch es ist noch nicht vorbei.
Die toten Bestien lösen sich in Rauch auf und ich höre ihr ent-setztes Jaulen, als sie zu dem Ort zurückkehren, von dem sie ge-kommen sind. Für einen kurzen Moment sehe ich verbrannte Erde und bleiche Knochen. Entsetzt schließe ich meine Augen.
„Gefällt dir nicht, was du gesehen hast? Gewöhne dich daran, denn wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dich zu diesen Knochen gesellen.“ Der Schwarzarbe verbirgt die Gehässigkeit in seiner Stimme nicht vor mir.
Leise antworte ich: „Wenn dies ein Traum von dir ist, muss ich dich enttäuschen. Es liegt nicht in meiner Absicht, ihn dir zu erfül-len. Eines Tages werde ich kommen und dir dein Leben nehmen.“
Er lacht über meine Worte und meint: „Wir werden ja sehen, wes-sen Vision sich erfüllen wird.“
„Dies ist kein Traum von mir“, entgegne ich.
Ironisch zieht er eine Augenbraue hoch. „Wenn es das nicht ist, was ist es dann?“ „Ein Versprechen“, flüstere ich.
Schweigend wendet er sich dem Kreis zu.
Fünf stolze Sieger stehen lauernd vor meinen Leuten. Sie so ster-ben zu sehen, erschüttert mich bis auf den Grund meiner Seele. Mit ihnen habe ich gelacht und getrunken, gekämpft und gesiegt. Sie sollten zu Hause sein, nicht hier an diesem verfluchten Ort.
Ich vernehme ihr böses Knurren, als sie langsam auf ihre Opfer zugehen. Die Männer weichen zurück und schlagen verzweifelt mit ihren blutigen Händen gegen eine unsichtbare Barriere, als sie an die weiße Linie kommen.
Statt sie sofort zu töten, spielen die Wölfe mit ihnen. Grausam la-ben sie sich an ihrer Furcht, trinken ihr Blut, saugen ihnen ihre See-le aus. Zerfetzen ihre Erinnerungen mit ihren Krallen, nähren sich von ihrer Angst und ihrem Schmerz. Die qualvollen Todesschreie ihrer Opfer ist Musik in ihren Ohren.
Als ihre Herzen aufhören zu schlagen, steigt schwarzer Nebel aus dem Boden, der die Gestalt einer Frau umtanzt. Ihr langes rotes Gewand erinnert mich an ein Gemälde, das ich im Haus über dem Bett eines Adeligen sah, dessen Leben ich nahm.
Unter einem grauen Himmel starren regungslose Krieger mit leeren Augen über eine düstere Landschaft, während ihr rotes Blut als Wasserfall in die Dunkelheit stürzt. In der Ferne steht eine Frau in einem roten Gewand und verbirgt ihr Gesicht hinter einer Maske.
Irgendwie kommt mir der Gedanke, dass diese Frau ihr Antlitz vor mir verbirgt. Auch frage ich mich, wer sie ist, als ich den Hauch ihrer Grausamkeit spüre, während sie das Geschenk der Wölfe an-nimmt. Fünf Seelen, die dazu verdammt sind, ihr bis in alle Ewig-keit zu dienen. Sie verschwindet genauso geheimnisvoll im Nebel, wie sie erschienen ist.
Die Wölfe bleiben zurück. Ihr Hunger ist noch nicht gestillt und mit gierigen Augen sehen zu mir. Einer nimmt Anlauf, setzt zum Sprung an. Enttäuscht jault er auf, als er gegen eine unsichtbare Wand klatscht.
Auch er kann die weiße Linie nicht übertreten. Ich bin entsetzt über die Lust zum Töten in seiner Mimik, als sich unsere Blicke kreuzen. Für einen Augenblick sehe ich durch seine Augen und nehme wahr, was er sieht.
Ein einsamer Krieger gefesselt an einem Pfahl, der Boden unter seinen Füßen durchtränkt von seinem Blut. Getrockneter Schweiß auf seiner Haut, Tränen auf seinem Gesicht, Hass in seinen Augen.
Meine zerrissene Seele schreit ihm eine Botschaft entgegen. Qual-voll keuche ich auf, als ich wieder den Wolf vor mir sehe. Nebel steigt aus den Boden und verhüllt die Bestien. Als er sich verzieht, sind auch sie fort.
Zurück bleiben verwischte Runen, vermischt mit dem Blut meiner Männer, die regungslos am Boden liegen und mit leeren Augen in den grauen Himmel starren.
Nur der Hexer ist noch da. Der Zahn der Zeit hat Furchen in sein einst schönes Gesicht gegraben. Wie ist das möglich, da das Alter dieses Volk nicht berührt.
Stillschweigend betrachtet er mich. Erkenne ich Mitleid in seinen Augen? Er murmelt Wörter in einer mir fremden Zunge, und wie durch Magie lösen sich meine Fesseln. Schmerzhaft kehrt das Le-ben in meine tauben Glieder zurück, als ich zum Becken gehen will, um mich zu säubern. Vier Wächter versperren mir den Weg, scheuchen mich wüst schimpfend zu dem Gefängnis.
Unnatürlich laut klingt das Knirschen der Scharniere, als einer mit einem rostigen Schlüssel die Zellentür aufsperrt. Er stößt mich hi-nein und knallt sie wütend hinter mir zu. Ich stürze zu Boden und halte meinen Blick gesenkt. Meinen Männern kann ich jetzt nicht in die Augen sehen. Tahres, mein engster Berater spricht mich an: „Komm Hauptmann, lass mich dein Blut abwaschen.“
Tränen rinnen über mein Gesicht, als ich leise sage: „Bei den Göt-tern, was habe ich getan?“ Ich schiebe seine Hand fort und flüste-re: „Nein, ich will nicht, dass ihr Trinkwasser vergeudet.“ Müde erhebe ich mich und gehe in meine Ecke, setze mich mit dem Rü-cken zur Wand. Doch die Bilder des Grauens kann ich nicht aus meinem Geist vertreiben. Wie aus weiter Ferne meine ich, immer noch ihre qualvollen Laute zu hören, und bin dankbar für das Schweigen meiner Männer. Was hätte ich auch sagen sollen?
Sie haben die Schreie gehört. Einige sehen immer wieder zu der Tür, obwohl sie wissen, dass sie nicht mehr zu uns kommen wer-den. Viele habe ich sterben sehen, als sie ihr Blut vergossen zum Wohle ihrer Heimat. Doch dieser Krieg war von Anfang an Wahn-sinn. Unschuldige ließen ihr Leben für den Stolz und den Hochmut der Adeligen.
Tahres unterbricht meine Gedanken. Verlegen steht er vor mir und hält mir eine Kelle mit Wasser hin. „Du siehst aus, als ob du etwas Schreckliches gesehen hast. Mein Hauptmann, wie lange kämpfe ich schon an deiner Seite? Die Männer sollten erfahren, was sie hier erwartet.“
Schweigend hören sie zu, während ich bedrückt erzähle, wie ihre Schwertbrüder ihr Leben aushauchten. Als ich ende, sind sie von der Grausamkeit unseres Feindes erschüttert.
Unter der Folter zu sterben, mit diesen Gedanken haben sie abge-schlossen. Sie sind Krieger und ihnen ist bewusst, dass der Tod ihr ständiger Begleiter ist.
Sich von magischen Wölfen zerfetzen lassen, um dann bis in alle Ewigkeit der Sklave einer Dämonin zu sein, diesen Tod fürchten sie. Ich sehe die Verzweiflung in ihren Gesichtern und mir ist be-wusst, dass ich etwas sagen muss.
„Ich weiß, wie wichtig die Reise zu den Göttern für euch ist. Es tut mir in meiner Seele weh, dass der Feind euch dies nehmen wird. Leider steht es nicht in meiner Macht, das zu ändern. Sollte einer von uns diesen Wahnsinn überleben, so wird er alles tun, um eure Seelen zu retten. Hier können wir nur mit Mut und Hoffnung im Herzen sterben. Denn das ist es, was der Feind uns nehmen will. Er hat vergessen, dass auch wir Krieger sind.“
Einige lächeln zaghaft und dann fängt einer zu singen an. Erst lei-se, aber sein Lied gewinnt an Kraft, als andere Stimmen mit einfal-len. Tahres drückt kurz meinen Arm und dann steigt auch er mit weittragender Stimme in den Gesang mit ein.
Morgen, da werde ich sterben und zu meinen Göttern gehen.
Doch heute werde ich singen, damit alle dies verstehen.
Zum Schutze und zum Wohle meiner Heimat zog ich in den Krieg.
Bruder Tod ritt an meiner Seite, führte mich von Sieg zu Sieg.
Doch ich werde nie vergessen, wie es zu Hause gewesen ist,
auch wenn mich morgen der kalte Mund des Todes küsst.
Ich schlief unter Bäumen, deren Kronen den Himmel berührten,
bevor böse Zungen und Taten mich in ein fremdes Land entführten.
Tote Freunde zu rächen, Lügen zu brechen, dafür zog ich den Stahl.
Ihr vergossenes unschuldiges Blut ließ mir keine andere Wahl.
Nicht lange wollte ich verweilen in des bösen Feindes Land,
doch dieses Schicksal liegt nun nicht mehr in meiner Hand.
So ziehe ich mit meinen Waffenbrüdern über fremde Erde,
und ich ahne, dass ich meine Heimat nie wiedersehen werde.
In den Reihen der toten Brüder, da werde ich morgen stehen,
und nie mehr den Himmel über meinen Bäumen sehen.
Denn Morgen werde ich sterben und zu meinen Göttern eilen.
Das Schicksal hat es so bestimmt,
ich darf nicht länger hier verweilen.
Doch heute werde ich singen, damit alle es verstehen,
warum mein Herz nicht mehr schlägt, warum ich musste gehen.
Dieses Lied hier an diesem Ort zu hören, lässt mich lächeln. Es ist gut, dass sie Erinnerungen teilen. Ihr Gemurmel begleitet mich in den Schlaf. Als ich nach ein paar Stunden aus ihm erwache, bin ich dankbar, dass die Träume fernblieben.
„Du bist wach, das ist gut“, begrüßt Tahres mich.
„Ist etwas passiert?“
„Sie haben uns Wasser und Brot gebracht. Schon seit Stunden hören wir die Trommeln.“
Ich seufze: „Sie werden ihre Toten zu den Göttern schicken. Dies ist nur eine kurze Frist. Wie geht es ihnen?“
„Du solltest dich zu ihnen setzen. Es macht ihnen Mut“, antwor-tet Tahres leise. Sie rücken zur Seite, als ich mich zu ihnen geselle. Meine letzten Männer, die Geschichten erzählen, lachen und scher-zen.
Am nächsten Tag wird der raue Klang der Trommeln lauter und auch in der Nacht verstummen sie nicht. Meine Männer singen und tanzen. Einige lieben sich, ungeachtet der Gefahr, die dies mit sich bringt. Manche machen ihre liebevollen Scherze darüber. So nutzt jeder die Stunden Leben, die ihm noch bleiben, auf seine Art und Weise.
Tahres gesellt sich zu mir: „Sieh dir diesen Haufen Barbaren an. Du wirst es vielleicht seltsam finden, aber ich freue mich auf die dummen Gesichter dieser arroganten Langlebigen. Wir werden das tun, was wir immer machen, wenn wir in die Schlacht ziehen und zeigen ihnen, wie wahre Krieger sterben. Wir werden singen, mein Hauptmann.“
Verdutzt sehe ich ihn an und muss ich über seine Worte lächeln. „Ich glaube nicht, dass ihnen dies gefallen wird. Sie mögen unsere Leben nehmen. Doch wie wir sterben, das können sie uns nicht nehmen. Komm lass uns singen, ich will tanzen.“